Historische Berichte zum Schachspiel in Ströbeck |
Aktualisiert am 28. Oktober 2018
Seit 1991 lautet der offizielle Name "Schachdorf Ströbeck" und so ist der Ort auch im amtlichen Verzeichnis der Postleitzahlen und in den Landkarten eingetragen. Es ist ein Ortsteil der Stadt Halberstadt im Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt. Das Schachdorf Ströbeck liegt 8 Kilometer von Halberstadt entfernt, hat etwas weniger als 1200 Einwohner, ein sehenswertes Schachmuseum und einen aktiven Schachverein.
Historisch interessant sind die besonderen Schachregeln, die sich in Ströbeck anders als die traditionellen Schachregeln entwickelt hatten. Noch bis ca. 1920 wurde im Schachdorf Ströbeck nach eigenen Schachregeln gespielt. Schon die Grundstellung war anders. Drei Bauern und die Dame waren jeweils zwei Felder vorgezogen. Die Figur des Bauern durfte aus der Grundstellung heraus nur ein Feld vorgezogen werden. Eine Besonderheit waren die sogenannten Freudensprünge. Ein auf die gegnerische Grundreihe gelangter Bauer musste, bevor er in eine andere Figur umgewandelt werden konnte, zunächst erst einmal in drei Freudensprüngen auf sein Ausgangsfeld zurückkehren. Die Ströbecker Regeln kannten auch keine Rochade.

Der berühmte Schachturm in Ströbeck
1011 soll ein adliger Gefangener des Halberstädter Bischofs
(angeblich Gunzelin von Kuckenburg) seinen Bewachern das Schachspielen
beigebracht haben.
1515 wurde zum ersten Mal das Schachspiel in Ströbeck schriftlich
erwähnt.
1616 wurden die drei Arten des Schachspiels im damaligen Ströbeck
im ersten deutschsprachigen Schachbuch Das Schach-Spiel oder König-Spiel
von Gustavus Selenus (d. i. Herzog August von Braunschweig-Wolfenbüttel)
ausführlich beschrieben. Zahlreiche Schachhistoriker beschäftigen sich
seitdem mit den eigenartigen Varianten, wie beispielsweise, dass ein
Bauer, der die achte Reihe erreicht hat, erst drei Freudensprünge
rückwärts machen muss, um sich in eine Dame verwandeln zu können.
1689 - seit diesem Jahr sind öffentliche Aufführungen von Schachpartien
in Ströbeck belegt,
bei denen die Schachfiguren durch verkleidete Menschen dargestellt
werden (sogenanntes Lebendschach). Diese Tradition hat sich bis heute
erhalten.
Der Suchbegriff "Schach" wurde zur schnelleren Orientierung in den nachfolgenden historischen Beiträgen hervorgehoben.
1840 schrieb Wilhelm Schönichen
(Pastor in Bernburg an der Saale und Güntersberge im Harz) in "Thüringen und der Harz"
Band 2: Schloss und Stadt Blankenburg am Harze:
Um zugleich ein skizziertes Bild vom schönen Idyllenleben am Hofe des
Herzogs Ludwig Rudolph zu liefern, so möge noch einiges aus dem
Jugendleben des letzten Hofdiakonus Valentin Söllig hier einen Platz
finden. Die glanzvollste Zeit im Jahre am Hofe dieses Fürsten war die
Karnevalszeit, zu welcher sich auch immer viele Fremde besonders
Offiziere aus Braunschweig, Wolfenbüttel, Hannover, Halberstadt,
Quedlinburg, Magdeburg und Anhalt hier aufhielten. Die Vergnügungen
bestanden in Vogelschießen, Scheibenschießen, Assembleen, Komödien,
Jagden mit Fuchs- und Hasenprellen, selbst Wasserjagden, an den
Ruhetagen wurden Feuerwerke auf dem Thie und Schnappelnberge abgebrannt,
und den Beschluss machte mehrenteils eine sogenannte adlige
Bauernhochzeit.
Ein Kavalier oder Offizier und ein Fräulein stellten das Brautpaar vor.
Der Herzog und seine Gemahlin waren Hochzeitsvater und Mutter, und so
wie sämtliche Hochzeitsgäste in Bauernkleidung waren, so wurde alles
nach Bauernmanier auch eingerichtet. Man fuhr mit Musik auf Bauernwagen
in der Stadt umher, wobei auch geschossen wurde. Man aß von hölzernen
Schüsseln und Tellern, wie es damals auf Dörfern noch üblich war nur mit
dem Unterschiede, dass diese Gerätschaften höchst sauber gefertigt
waren. Bei Tische wurde gescherzt, gesungen, gelärmt, alles plattdeutsch
gesprochen, aus großen Passgläsern getrunken, in welche aus verpichten
hölzernen Kannen der Wein eingeschenkt wurde. Hierauf wurde getanzt und
so der Tag unter der herzlichsten Freude beschlossen.
Außer dieser fingierten Hochzeit wurden aber an dem nämlichen Tage
einige Trauungen von Bauern wirklich vollzogen. Sechs bis sieben
Hochzeitspaare aus den benachbarten Dörfern kamen nämlich nacheinander
auf ihren Erntewagen mit voller Musik auf den Schlossplatz gefahren.
Jedes Paar wurde von seinen eigenen Dorfmusikanten mit Blasinstrumenten
nach der Schlosskirche begleitet. Daselbst wurde wirklicher Gottesdienst
gehalten, die fürstliche Kapelle erhöhte die Feier, und nach gehaltener
Traurede wurden von dem Hofprediger sämtliche Brautpaare nun copulirt.
Diese fuhren dann mit allen ihren Gästen nach dem sogenannten Judenhofe
(der neuen Faktorei) wo Redoute gehalten wurde, und der Herzog ließ sie
daselbst aufs herrlichste bewirten und beschenken.
Die Schilderung dieser Hochzeiten gelangt auch nach Ströbeck, dem durch
sein Schachspiel berühmten Flecken unfern Halberstadt. Hier ist nun die
alte Sitte, wenn eine Hochzeit statt findet, so begeben sich sämtliche
Hochzeitsgäste auf die Ratsstube, woselbst ein Schachspiel nebst den
Gerechtsamen und Dokumenten der Ströbeckschen Bauern befindlich ist, und
der Bräutigam ist dem Herkommen gemäß genötigt, um die Braut zu spielen.
Die Gäste suchen den geschicktesten Spieler unter sich aus, und machen
alle Partie gegen den Bräutigam. Sie dürfen indessen zum Spiele nichts
sagen, außer wenn sie vermuten, dass auf ihrer Seite ein misslicher Zug
geschehen könnte, so warnen sie nur ganz unbestimmt ihren Spieler:
Vadder mit Rahd ... Gevatter mit Rat! (oder Bedacht!). Gewinnt der
Bräutigam das Spiel, so ist die Braut ohne weitere Umstände sein, wo
nicht, so muss er sie von den Hochzeitsgästen durch ein gewisses
Äquivalent erst lösen. So war es ehedem.
Da nun die Ströbeckschen Bauern hören, dass in Blankenburg ähnliche
Hochzeiten nachgeahmt würden, so halten sie es für keinen unzeitigen
Einfall, wenn sie eine Deputation abschicken, um dem Hofe vorzustellen,
dass das Ströbecksche Hochzeitsrecht wegen des Schachspiels nicht außer
Acht gelassen werden möchte. Zwei Bauern, unter welchen des genannten Sölligs Vater, der damals für den besten
Schachspieler und den
beredtesten unter ihnen gehalten wurde, machen sich also auf den Weg,
nehmen von der Herrenstube auf dem Rathause das große schön gearbeitete
Schachspiel nebst den dabei befindlichen Dokumenten oder vielmehr des
Herzogs August unter dem Namen "Gustavi Seleni" herausgegebene Anweisung
zum Schachspiel mit sich, und lassen ihre Ankunft dem Herzoge unter
folgendem Vortrage melden: "Sie hätten gehört, wie der Herzog in
Blankenburg adelige Bauernhochzeiten anstellte, man möge also auch die
bei ihnen übliche Bauernmode mitmachen. Bei ihnen sei es Brauch, dass
der Bräutigam die Braut sich erst im Schach erspielen müsse, sonst dürfe
er nicht ein Lager mit ihr teilen." Der Antrag wird sehr gnädig
aufgenommen. Der Herzog nebst Gemahlin lassen sie vor sich kommen, reden
mit ihnen höchst herablassend, erkundigen sich nach ihren häuslichen
Umständen, es wird ihnen alles Sehenswerte gezeigt, sie müssen bei allen
Feierlichkeiten zugegen sein und lassen es sich so sehr bei Hofe
gefallen, dass ihre Anwesenheit wohl vierzehn Tage gedauert hat. Der
Herzog fragt Sölligen, ob er Söhne habe? – Ja! Ob sie auch Schach
spielten? – Ja! – Ob er ihm wohl einen davon überlassen wollte? Er
erwidert, wenn derselbe dem Herzoge nicht missfiele, so wäre er dazu
bereit. Söllig nimmt also nach einigen Tagen seinen muntern achtjährigen
Knaben Johann Valentin, den dritten von vier Söhnen und den Gegenstand
unserer Erzählung, mit sich auf das Pferd und reitet nach Blankenburg.
Weil aber der Herzog von einer kleinen Unpässlichkeit befallen gewesen,
so kann er nicht zur Audienz gelangen, und reitet also unverrichteter
Sache wieder zurück. Einige Tage danach, als der Herzog genesen, bekommt
Söllig einen expressen Boten mit der Nachricht, er solle sogleich seinen
Sohn überbringen. Er macht sich daher ungesäumt zum zweiten Male auf den
Weg und überbringt ihn. Die unbefangene Munterkeit des Knaben gefällt
beiden fürstlichen Personen so sehr, dass sie dem Vater das Anerbieten
tun, wenn er ihnen seinen Sohn überlassen wolle, so würde der Herzog für
sein Glück sorgen und ihn entweder studieren oder alles, wozu er sonst
Lust bezeugen würde, erlernen lassen. Söllig bedenkt sich ein wenig, ob
es wohl nicht gegen die väterliche Liebe sei, ein Kind von sich weg zu
geben, entschließt sich doch aber endlich mit den Worten dazu: Der
Herzog möchte den Sohn nur hinnehmen, wenn er ihm nicht mehr gefiele, so
möge er ihn wieder heimschicken, er habe selbst Brot für ihn. Der Glanz
des Hofes und die Liebkosungen der Herrschaft und aller Hofbedienten,
welche ihn nur den kleinen Schachspieler nennen, machen den Knaben so
freudetrunken, dass er an nichts weniger denkt, als je wieder nach
Ströbeck zurück zu kehren. Er wird übrigens sogleich städtisch
gekleidet, frisiert; jedermann reißt sich um ihn wegen des Schachspiels;
es wird ihm ein Informator gehalten, und der damalige Bibliothekar und
nachherige Reichshofrat Knörr bekommt die Oberaufsicht über ihn, welcher
bei Gelegenheit ihn auch selbst unterrichtet hat. Sein Beruf ist, jeden
Abend um 6 Uhr in der Assemblee zu sein, wenn etwa der Herzog oder
dessen Gemahlin Schach zu spielen beliebten. Wenn nun jemand von ihnen
mit dem kleinen Schachspieler gespielt hatte, so wird er gewöhnlich nach
beendigtem Spiele mit einigen Talern beschenkt. Auf Befragen des
Herzogs, was er werden wollte, erwiderte er: ein Prediger. Der Herzog
versichert, dass er gern die Kosten dazu hergeben wolle, er solle nur
fleißig lernen, so könne er dereinst Superintendent werden. Da er nun
den Wünschen des Herzogs entsprach und sich dessen Liebe bewahrte, so
begleitete er ihn auch auf seinen Reisen von Blankenburg nach
Braunschweig etc. Seine Schuljahre legte er in Blankenburg zurück und
studierte nachher in Helmstedt vier Jahre Theologie unter dem Abt Mosheim, dem er besonders anbefohlen wurde. Als er im Begriff stand, die
Universität zu verlassen, starb Ludwig Rudolph, aber die verwitwete
Herzogin nahm ihn darauf wieder nach Blankenburg zu ihrem
Pagenhofmeister, und im Jahr 1739 zum Hofdiakonus, bis er nach dem Tod
derselben, 1749 Prediger in Hasselfelde wurde.
Er hat sich zweimal verheiratet. Seine erste Frau, vorher Kammerfrau der
Herzogin, war eine geborene Moll und Predigerstochter aus Münchsrode in
Schwaben, deren Familie späterhin geadelt und jetzt in Österreich sehr
hoch gestellt ist; die zweite eine geborene Koch, eine Predigerstochter
aus Thale und verwandt mit dem berühmten Leukfeld und Ernesti. Aus
beiden Ehen zeugte er 13 Kinder, von denen jetzt noch zwei, Enkel,
Urenkel und Ururenkel aber sehr viele am Leben sind.
Er hat zwar unter den Gelehrten keinen Namen erhalten, erwarb sich
jedoch außer seinen Amtswissenschaften sehr gründliche Kenntnisse in der
lateinischen und, was damals selten war, in der griechischen Sprache.
Letztere gab, als er noch Pagenhofmeister war, zu folgendem Vorfalle
Gelegenheit:
Es kamen nämlich einst zwei angesehene Griechen, ein Abt und ein Pater
von der Insel Kios, welche schon an mehreren Höfen zur Erbauung eines
Klosters Geld eingesammelt hatten, auf Empfehlung des verwandten
kaiserlichen Hofes in Wien, nach Blankenburg. Einer von diesen Griechen
konnte außer seiner Muttersprache nur etwas Französisch reden. Die
Herzogin, vielleicht in der Meinung, dass ein Studierter jede Sprache
bis zur Fertigkeit im Reden lerne, fordert die Griechen auf, ihren
Pagenhofmeister anzureden, welcher allezeit bei der Tafel anwesend und
die Pagen beobachten musste. Dies geschieht. Söllig hilft sich so gut
als er kann, und bittet nur die Griechen im attischen Dialekte mit ihm
zu reden. Das Erste ist, dass sie ihm seinen Aetacismus abzugewöhnen
suchen, und machen sich so einander notdürftig verständlich. Die
Griechen halten sich 14 Tage in Blankenburg auf, werden täglich nach
Hofe geholt, des Abends bleiben sie aber in ihrer Wohnung, bitten Söllig
zu sich, der sich auf diese Besuche mit größter Sorgfalt vorbereitet,
und nun ihr täglicher Gesellschafter, bester Freund und Dolmetscher
wird.
Sie haben eine so herzliche Freude über den Vorfall, dass sie die
Herzogin versichern, auf ihren Reisen durch mehrere Länder außer dem
Erzbischof von Canterbury niemand gefunden zu haben, mit dem sie in
ihrer Muttersprache hätten reden können. Sie machen ihm verschiedene
Male den Antrag, ihn mit Bewilligung der Herzogin auf sieben Jahre als
Dolmetscher an deutschen Höfen und dann weiter auch nach Frankreich,
Spanien, Portugal etc. mitzunehmen. Allein mancherlei Bedenklichkeiten
bewogen ihn, diesen Antrag auszuschlagen, zumal da die Herzogin nicht
dazu hat raten wollen. Als Hofdiakonus hat er auch das eben so seltene
als merkwürdige Geschäfte gehabt, eine gefangene Türkin Abbas Kaechianen
Kaefe Rhebisch, später die Gattin des Pastors L. M. Grimm zu Heimburg,
welche die Herzogin als Kammerfrau zu sich genommen hatte, im
Christentume zu unterrichten und nach öffentlicher Konfirmation zum
heiligen Abendmahle der lutherischen Kirche hinzuzulassen.
Solche Aufmunterungen, als damals die Ströbeckschen Bauern hatten,
mussten ihnen freilich wohl den Wert ihres Schachspieles sehr schätzbar
machen. Sölligs Vater wurde schon oft zu dem damaligen alten Grafen von
Wernigerode geholt, um mit ihm Schach zu spielen, auch in gleicher
Absicht zu verschiedenen Eheleuten und anderen vornehmen Personen in der
Nachbarschaft. Auch wenn Fremde kamen, um das Schachspiel zu sehen oder
zu spielen, wurde Söllig gerufen, und sein kleiner Sohn begleitete ihn
allzeit und spielte auch oft statt seiner.
Daher kann man sich erklären, wie er es wagen konnte, sich dem
Blankenburgischen Hofe mit jener Dreistigkeit vorzustellen. Damals wurde
das Schachspiel von allen Bauern jungen und alten auch sogar in den
Wirtshäusern gespielt, die auch das Schachbrett im Schilde führen. Es
ist danach einmal etwas ins Abnehmen gekommen; allein neuerdings ist der
Sinn und die Liebe dazu auf den Wunsch Sr. Majestät des edeln Königs
Friedrich Wilhelm und durch Aufmunterung des dasigen Herrn Landrats
wieder sehr geweckt worden, besonders dadurch, dass man am Tage des
jährlichen Schulexamens Schachspiele als Prämien für die bestspielenden
Schulkinder ausgesetzt hat. Es wird daher jetzt wieder in jedem Hause
ein Schachspiel angetroffen, und der dasige Prediger führt eine Chronik
über des Schachspiel und seine besten Spieler in Ströbeck.
Der Sage nach soll das Spiel unter dem Bischof Burkhard oder Bucko I.
von Halberstadt 1040 - 45, der an den Feldzügen Kaiser Heinrichs III.
gegen die Wenden teilnahm, durch einen gefangenen Wendenfürsten, der in
Ströbeck in einem Turme festgehalten wurde, dorthin gekommen sein. Der
Turm wird noch gezeigt, und um die Einsamkeit seiner Haft sich zu
mildern, habe er seinen Wächtern das Schachspiel gelehrt.
Die Ströbeckschen Bauern spielen das Schachspiel deshalb nach ihren
eigenen Regeln und mit einer Einfachheit und Würde, die weit erhaben
ist. Sie setzen die Ehre des Spieles nicht darin, ihren Gegner
schachmatt zu schlagen, sondern ihn schachmatt zu ziehen. Denn das
Schachspiel hört auf, ein Verstandesspiel zu sein und wird bloßes
Glücksspiel, sobald man es nur darauf absieht, sich einander die Steine
vom Brette zu schlagen. Das sogenannte Kapern, wo man, um dem Gegner
drei Steine zu nehmen, zwei von seinen eigenen aufopfert, ist in
Ströbeck daher ganz außer allen Gebrauch. Kenner wissen, wie unangenehm
es ist, wenn man nicht mehr mit der vollen Kraft aller Steine spielen
kann. Hat man aber einen mutwilligen Gegner, der selbst keinen gehörigen
Plan entwirft und es auf alle Weise zu verhindern sucht, dass auch der
Gegner keinen entwerfen soll, sondern bei der geringsten Ahnung, dass
man ihm, ich will nicht sagen, nach dem dritten oder vierten Zuge,
sondern nach zwanzig Zügen gefährlich werden könne, Stein um Stein
schlägt, der raubt dem Spiele seine Seele. So spielt man in Ströbeck
nicht, sondern schont die Steine so viel als möglich auf beiden Seiten,
und verliert lieber für diesmal ein Spiel, als es auf eine weniger
großmütige Art zu gewinnen, oder wie das gewöhnlich der Fall ist, wenn
man das Brett zu sehr von Steinen entblößt, den Sieg von beiden Teilen
unentschieden zu lassen. Es mag daher wohl eben nicht so schwer sein,
durch manche der Natur des Spieles zuwider laufende Ränke einem
Ströbeckschen Bauer, der bei der Regel bleibt, ein Spiel abzugewinnen,
aber schwerlich wird man ihn dahin bringen, in seinem Überwinder auch
zugleich seinen Meister zu erkennen.
- Ende des Beitrages von Wilhelm Schönichen -
1848 im Dezember schrieb der Theologe und Schriftsteller Otto
Friedrich Wehrhan den Beitrag Neueste Nachrichten aus Ströbeck. Otto
Friedrich Wehrhan, geboren am 05.03.1795 in Liegnitz Neisse, verstorben am 02.08.1860
in Coswig, lebte von 1824 bis 1835 in Kunitz, 1841 in Hamburg und kaufte 1842 den Zimmerhof in Coswig.
Sein Beitrag über das Schachdorf Ströbeck erschien in der Leipziger "Illustrirte
Zeitung Nr. 283" am 2. Dezember 1848 auf Seite 372:
Es war Ende August, eines Sonntags mittags, als ich von Halberstadt aus
einen Spaziergang nach dem eine Meile entfernten Ströbeck machte. Ich
musste doch, bei solcher Nähe, dies Dorf, das einzige in seiner Art auf
dem ganzen Erdboden, wo Schachspieler in allen Häusern sind und alles
Schach spielt, kennen lernen? Ich wollte doch, und dies war mir das
Wichtigere, sehen, ob solch eine geistige Unterhaltung, allgemein
geworden, einen merklichen Einfluss auf die Sitten des Volkes übe, ob,
mit anderen Worten, die Ströbecker Bauern gebildeter, anständiger,
veredelter seien, als die Bauern kartenspielender und kegelschiebender
Dörfer? Und so schritt ich denn mit wahrer Neugierde den prosaischen
Feldweg über die völlig baumlose Ackerflur dahin, an deren Horizonte ich
schon gleich hinter Halberstadt die kegelförmige Kirchturmspitze von
Ströbeck ragen sah, und erreichte endlich, ungefähr um 1 Uhr das etwas
eingesenkt liegende Dorf.
Nun, die Häuser, nach dortiger Landessitte auch an den Wänden oft mit
Dachziegeln bekleidet, sahen recht nett und wohlhäbig aus, und die
Jünglinge und Weiber, die mir begegneten, grüßten, was alles mich, der
Ehre des Schachspiels wegen freute. Bei der Kirche vorbei gelangte ich
auf einen freieren, unregelmäßigen Platz, auf welchem der Hauptgasthof,
zugleich Rathaus des Ortes, stand; nicht weit von ihm, zur Linken, ein
uralter, viereckiger Turm, der wie aus der Ritterzeit in die Neuzeit
herüberschaute, und über der Eingangtüre des ersteren fiel mir alsbald
das Wappen des Ortes, ein in Stein gearbeitetes, schwarz und weiß
gemaltes Schachbrett ins Auge, welches mir im Vergleich mit den Bären,
Hirschen, Rossen, Adlern, Löwen etc., die man sonst gewöhnlich als
Gasthofschilder sieht, recht originell erschien.
Ich trat ein. Die Gaststube war ungewöhnlich klein für ihre Bestimmung,
aber weiß getüncht und rein. An dem größten der drei Tische saß ein Herr
im Überrock und ein schon ziemlich bejahrter Mann im blauen Überhemd und
mit treuherziger, ansprechender Miene, der – es war der Wirt – sogleich
aufstand, seine runde Dachsmütze rückte, mir die Hand bot und mich zum
Sitzen einlud. Da war wieder ein Schachbrett, auf der Mitte des Tisches
mit Ölfarben gemalt, zu schauen; aber ich tat, als bemerke ich es gar
nicht, fragte: was ich zu essen bekommen könne? Und nachdem mir
geantwortet worden, dass das eigentliche Mittagsmahl hier schon vorbei
sei, dass mir aber ein Eiergericht mit kaltem Schinken zu Diensten
stehe, unterhielt ich mich, während das Gericht bereitet wurde, mit dem
Wirt und jenem Herrn im Überrocke von ganz anderen Dingen, von Politik,
von der Umgegend, vom Feldbau, und tat, in der Erwartung, jene würden
vom Schachspiel mit mir zu reden anfangen, in Bezug auf Letzteres
immerfort wie Unverstand. Ich wollte nämlich zwar nicht, wie einst Silberschmidt, die dortigen Bauern zum hohen Spiel um Geld mit mir
verleiten – dazu hatte ich auch lange nicht genug Vertrauen zu mir –,
aber ich wollte nicht, dadurch, dass ich die Sache auf die Tafel
brachte, den Schein eines großen Schachspielers, der etwa hergekommen
sei, um sich mit den Ströbeckern zu messen, auf mich laden. Da aber
auch, nachdem ich mein Mahl beendigt, jene Beiden nicht den gewünschten
Gegenstand berührten, so konnte ich mich endlich nicht enthalten, auf
das Schachbrett des Tisches zeigend, zu fragen: "Dies Spiel wird wohl
hier gespielt?" – "Das versteht sich", erwiderte der Herr im Überrock,
"hier spielt alles Schach, dafür ist Ströbeck berühmt; spielen Sie
vielleicht auch?" – "Ich liebe das Spiel, aber gegen solche Virtuosen,
wie hier, möchte ich wohl den Kürzeren ziehen." – "Nun, wenn Ihnen eine
Partie gefällig ist, so wollen wir eine machen." – Hierauf wurde denn
sogleich ein anderes, mobiles Schachbrett hereingebracht, auf dessen
Rande ich mit Verwunderung in zierlich gemalten Zügen las: "Dorothea Wiedebein, zur Belohnung des Fleißes, 1833." – "Also auch die Mädchen
spielen hier?" – "Jawoll, und zwar von der Schule an. Alle Jahre beim
Schulexamen werden sie auch im Schachspiel geprüft; aber das Spiel wird
ihnen nicht in der Schule, sondern zu Hause von den Eltern gelehrt."
Jetzt wurden von uns die hölzernen Figuren aufgestellt. Aber da zeigte
sich schon eine bedeutende Verschiedenheit zwischen unserem Spiel und
dem Ströbecker Spiele. Der Doktor des Dorfes – denn dieser war der Herr
im Überrock – sagte mir nämlich, dass man hier die Bauern der Türme der
Königinnen und die Königinnen selbst zwei Schritte vorwärts aufstelle
und dass das die echte ursprüngliche Aufstellung des Schachspieles sei,
auch dass der Bauer nie – ausgenommen bei der Aufstellung – zwei
Schritte auf einmal tun dürfe, dass Rochieren nie stattfinde, und dass
der Bauer, welcher in die Königslinie des Gegners dringt, nicht eher in
die Rechte einer Königin oder eines beliebigen Offiziers eintrete und
also auch nicht eher dem feindlichen König Schach bieten dürfe, als bis
er die sogenannten drei Freudensprünge getan, d. h. in drei
zurückgehenden Sprüngen seine erste Stelle wieder eingenommen habe.
Indes, fügte er hinzu, wolle er recht gern nach meiner Art zu spielen
sich richten, sowohl bei der Aufstellung als beim Ziehen, was ich – da
ich einst gehört oder gelesen hatte, dass die Ströbecker bei ihrer Art
sich aufzustellen, wenn sie den Anzug haben und richtig fortfahren,
gewinnen müssten, auch dankbar annahm.
Der Kampf begann; von meiner Seite, fast mit der gewissen Voraussicht,
geschlagen zu werden, aber doch mit der äußersten Vorsicht und
Anstrengung, um wenigstens meinem Gegner den Sieg so schwer als möglich
zu machen; aber nach und nach, siehe da! – kaum traute ich der
Wirklichkeit – ich erhielt einige Vorteile über ihn, ward allmählich
reicher an eroberten Figuren als er, immer bedeutender wurde mein
Übergewicht, und endlich war es mir gewiss, dass, wenn ich nicht grobe
Böcke mache, der Sieg mir werden müsse. Dies erkannte auch der
zuschauende Wirt und der unterdes herzugekommene erwachsene Sohn
desselben, und bald ertönte von meiner Seite das "Schach und Matt!"
Indes, der Sieg war durch mehre Umstände in seinem Werte verringert.
Erstens hatte sich der Doktor nach meiner, ihm nicht so gewohnten
Spielart gerichtet, und zweitens war er, wie mir nun der Wirt erzählte,
kein geborener Ströbecker, sondern erst seit, ich glaube, sechs Jahren
dort und hatte das Spiel erst in Ströbeck gelernt. Die besten Spieler
des Ortes sollten sein ein Bauer Valentin Guerike und ein Zimmermann
Krafft, ein schon siebenzigjähriger Mann, aber noch voll Geist und
Leben, der nie Tabak rauche, nie Schnaps trinke und noch so rüstig sei,
dass er ohne Mühe mehre Meilen des Tages zu Fuße geht. Aber keiner von
beiden war da, und ob sie noch kommen würden, war ungewiss.
Bei so bewandten Umständen und da auch der Doktor zu einem Kranken
musste, von wo er erst um drei Uhr wieder zurückzukommen gedachte,
benutzte ich diese Muße, um einen Vorsatz auszuführen, den ich schon in
Halberstadt gefasst, nämlich zum Pastor zu gehen und mir von diesem, der
gewiss die besten Quellen dazu besitzt, das Geschichtliche der
Einführung des Schachspiels in Ströbeck mitteilen zu lassen. Und meine
Hoffnung ward über Erwarten erfüllt, indem ich nicht nur mündlich das
Wesentliche erfuhr, sondern auch eine Broschüre: Kurzgefasste
historische Nachrichten von Ströbeck; gesammelt und mitgeteilt von Carl
Elis; Halberstadt 1843, bei C. H. F. Dölle" zum Geschenk erhielt. Aus
dieser erfuhr ich unter anderem, dass Ströbeck in uralter Zeit
Ostar-Beck, d. h. Oster-Bach – von dem dicht dabei liegenden Osterberge,
in welchem heute noch Urnenscherben und Fragmente von Opfermessern
gefunden werden, und dem die Göttin Ostera geweihtem Bache, welcher an
seinem Fuße fließt – dann Ostrebeck geheißen habe, woraus endlich, durch
Weglassung des O, Strebeck geworden sei, dass ferner schriftlich der Ort
zuerst in einer Urkunde vom 1. August 1004 vorkomme, und dass die
bekannte Familie v. Strombeck, früher v. Ströbeck genannt, und lange im
Besitz des Dorfes, von diesem Gute ihren Namen führe. Was aber das
Geschichtliche des hiesigen Schachspiels betrifft, so will ich, was das
Büchlein davon erzählt, hier wörtlich wiedergeben.
"Der Bischof Arnulph bekam 1011 vom Kaiser Heinrich II. einen vornehmen
Staats- und Kriegsgefangenen, den Grafen Guncellin, überwiesen, damit er
ihn, ohne dass es jemand erfahre, in dem alten Turme, der noch jetzt im
Dorfe steht, so lange gefangen halte, bis der Bischof weitere Befehle
darüber erhalten werde. Es mussten nun immer die Bauern abwechselnd bei
ihm Wache halten und da diese sehr glimpflich mit dem Grafen umgingen,
so unterhielt er sich sehr freundlich mit ihnen, schnitzte aus
Langeweile Schachfiguren, fertigte ein Brett an und ward, um sich selbst
besser die Zeit vertreiben zu können, nun der Lehrer im Schachspiele,
worin er Meister war. Mit großer Lust und mit Eifer ergriffen nun die
Bauern diese Gelegenheit, ein so schönes Spiel zu lernen und bald kannte
man im Dorfe kein anderes Spiel mehr. Als er dann nach längerer Zeit
wieder in Freiheit gesetzt wurde, beschenkte er die Bauern mit seinem
Schachspiel, und auf diese Weise sind bis auf den heutigen Tag die
Männer von Ströbeck immer noch Meister im Schachspiele."
"Eine andere Tradition ist diese: Als Bischof Burchard II. auf seinem
Heerzuge gegen die Wenden 1068 einen vornehmen Wenden gefangen nahm,
ließ er ihn in den Ströbecker Turm sperren und machte die Wenden damit
bekannt, ihn so lange gefangen zu halten, bis sie die
Friedensbedingungen erfüllten und ein ansehnliches Lösegeld schickten.
Dieser vornehme Wende lehrte die Ströbecker das Schachspiel und
verkürzte sich dadurch die unangenehme Zeit seiner Gefangenschaft."
Man sieht, dass beide Traditionen eine und dieselbe Geschichte erzählen,
selbst in den Jahreszahlen sind sie nicht weit auseinander, und
wahrscheinlich ist dieser vornehme Wende jener Graf Guncellin gewesen.
Durch die Ähnlichkeit dieser beiden von einander unabhängigen
Traditionen wird ihre Wahrscheinlichkeit verstärkt. Das Büchlein fährt
hierauf also fort:
"Seit dieser Zeit haben die Ströbecker das Recht, jedem neuen
Landesherrn, der ihren Ort berührt, auf freiem Felde auf einem Tische
eine Partie Schach anbieten zu dürfen, welches sie bisher auch immer
getan haben."
"Friedrich Wilhelm der Große, Kurfürst von Brandenburg, fand bei seiner
Durchreise Vergnügen daran, die Schachvirtuosen zu prüfen, und dieser
humane Fürst fand mehr, als er erwartete, weshalb er dem Dorfe das noch
jetzt als Reliquie aufbewahrte, mit Elfenbein ausgelegte Schachbrett
verehrte. Auf der einen Seite dieses Schachbretts sind die Felder des
Schachspiels, auf der anderen die des Courierspiels. Auf seinen Rändern
sieht man Ströbeck in erhabener Arbeit mit der Umschrift: "Dass Sereniss.
Churfürstliche Durchlaucht von Brandenburg und Fürst von Halberstadt,
Herr Friedrich Wilhelm, dieses Schach- und Courierspiel am 13. Mai 1651
dem Flecken Ströbeck aus sonderl. Gnaden verehret und bei ihrer alten
Freiheit zu schützen, zugesaget, solches ist zum ewigen Gedächtnis hier
aufgezeichnet.
Paul Langenstraß. B. Valentin Rieche, Richter. Andreas Bartels, Baur. Meist. Hans Ilsen. B. Valent. Langenstraß, Richter. Hans Hartmann, Baur. Meist."*)
Rénovatum Anno 1744. M. Heinrich Wilke me fecit.
*) Schulze. Dass zwei Bauermeister angeführet sind,
kommt daher, weil Ströbeck aus zwei Teilen, dem Süder- und dem
Norder-Dorfe besteht.
Die Figuren zu diesem Schachbrette waren der eine Teil Silber,
der andere Teil Silber und vergoldet. Durch Verleihen ans Domstift zu
Halberstadt sind aber diese Figuren abhanden gekommen und man spielt
jetzt mit elfenbeinernen Figuren."
Doch nun wieder zurück zu meiner Erzählung. Um 3 Uhr begab ich mich
wieder in den Gasthof, dessen Stube ich unterdessen mit Bauern, alle in
blauen Blousen, runden Dachsmützen und hohen, bis über die Knie
reichenden Stiefeln, gefüllt hatte, wurde vom Wirte mit sichtbarer
Freude begrüßt und unterhielt mich, da der Doktor noch nicht angekommen
war, einstweilen mit den Anwesenden über dieses und jenes. Kaum war der
Doktor eingetreten, so forderte er mich zur Fortsetzung des Kampfes auf,
die Figuren wurden wieder aufgestellt – nach unsrer Art – die Bauern
versammelten sich als Zuschauer um den Tisch her und ich begann, jetzt
mit zuversichtlicherem Mute als das erste Mal, mein Spiel. Ich siegte
abermals, auch eine dritte Partie gewann ich und hätte auch noch eine
vierte mit dem Doktor gemacht, wenn mir jetzt nicht ein ältlicher,
hochgewachsener Bauer, mit blassem aber geistreichem Gesicht, der sich
unterdes an meine Seite gesetzt hatte und mit großer Aufmerksamkeit dem
Spiele zusah, als Valentin Guerike genannt worden wäre. Zugleich wurde
er aufgefordert, dass er es doch einmal mit mir versuchen möge, und nach
einigem Sträuben ging er darauf ein, jedoch nur unter der Bedingung,
dass nach Ströbecker Art aufgestellt und gespielt werde. Das war nun
freilich ein bedeutendes Gewicht in die Waagschale meines Gegners, indes
beobachtete ich die Taktik, ihm, der den Auszug gehabt hatte, die ersten
vier bis fünf Züge nachzutun, bis sich nach und nach ein Spiel gebildet
hatte, in welchem der originelle Anfang verwischt war und in welchem ich
mich nun mehr zu Hause befand. Es war ein schwerer Kampf. Guerike
spielte mit großer Feinheit und Vorsicht und entschieden besser als sein
Vorgänger, und ein paar Mal geriet ich so in die Klemme, dass ich die
Hoffnung des Sieges so gut wie aufgab. Aber es gelang mir durch Tausch
der Königinnen Guerike's gefährlichen Plan zu zerstören und mich in eine
bessere Stellung zu bringen, und endlich, nachdem ich mit einem
tapferen, wohl unterstützen Bauer nur noch einen Schritt von seiner
Königslinie stand und er es nicht mehr verhindern konnte, dass ich
einrückte und meinen Bauer zur Königin machte, gab er das Spiel
verloren. Ich gestehe, es war mir dies lieber, als wenn er bis zum Ende
weiter gespielt hätte, denn obwohl der Bauer, so lange er noch in der
oberen Reihe steht, nicht geschlagen werden kann, so ist er doch,
während er seine Freudensprünge tut, dem Feinde völlig preisgegeben, so
dass dieser ihn unterwegs schlagen kann, wo er ihn zu erreichen vermag,
und vielleicht hätte ich, bei meiner Unbekanntschaft mit diesem Spiele,
die Partie dadurch noch verloren.
So war ich denn immer Sieger geblieben und schied auch als solcher von
Ströbeck. Zwar wollte der Doktor – Guerike hatte keine Lust mehr dazu, –
dass ich noch wenigstens einen Gang mit ihm mache und redete mir eifrig
zum Bleiben zu, aber der Abend nahte und ich war in Halberstadt für acht
Uhr zu einem Freunde zum Abendbrot geladen. Ich dankte daher, so gern
ich sonst noch länger geblieben wäre, nahm, mit dem Versprechen, bei
Gelegenheit wieder zu kommen, Abschied von den lieben Ströbeckern, ließ
mir von dem Wirte, der mich nun erst nach meinem Namen und meiner Heimat
fragte, nur noch jenes vom Kurfürsten von Brandenburg geschenkte
Schachbrett zeigen, welches oben, im Sessionszimmer des Gasthofes –
Rathauses – verschlossen aufbewahrt wird, und schritt dann, von meinem
Besuche in Ströbeck recht befriedigt, nach dem hochgetürmten Halberstadt
zurück.
Was nun den Hauptzweck meines Besuches betrifft, nämlich den Einfluss
des Schachspiels auf die Bevölkerung zu beobachten, so kann ich sagen,
dass der Eindruck, welchen die Ströbecker auf mich gemacht haben, ein
sehr günstiger gewesen ist. Sie sind ein gesetzter, verständig
aussehender, biederer Menschenschlag, unter dem ich, wenigstens während
der sechs Stunden meines Verweilens unter ihnen, keine Gemeinheit, noch
weniger Rohheit bemerkt habe. Zwar sagte mir der Pastor, dass in den
letzten Jahren das Kartenspiel anfange das Schachspiel zu verdrängen;
indes hat wenigstens in meiner Gegenwart das Interesse für das
Schachspiel das für das Kartenspiel überwogen, denn alle Bauern schauten
zu, während ich spielte, und die hin und wieder halblaut geäußerten
Urteile über die Züge waren meist sehr richtig und umso interessanter,
als sie aus dem Munde solcher Blousenmänner kamen, von denen man
dergleichen zu hören gar nicht gewohnt ist.
Was jedoch die Virtuosität der Ströbecker im Schachspiele betrifft, so
ist es, wie ich auch von mehren Seiten gehört habe und wie meine eigenen
Siege beweisen, leider wahr, dass sie in Verfall ist. Nimmermehr können
die Ströbecker hierin mit einem Pöschmann in Leipzig, einem Anderssen in
Breslau, einem Schmeichel in Hamburg etc. sich messen, diese würden
selbst beim Vorgeben von Figuren noch gewinnen, und glaube ich, nie eine
Partie gegen sie verlieren. Möchte bald wieder ein Guncellin, wenn auch
nicht als Gefangener, ihr Schachspiel heben!
- Ende des Artikels von O. Fr. Wehrhan -
1849 publizierte Max Lange in seiner Magdeburger
Schachzeitung ab Seite 84 (mit Fortsetzung auf Seite 106 und Schluss
auf Seite 116) einen Beitrag von Moritz Krüger unter der Überschrift:
Skizzen aus Ströbeck
(Gesammelt von Moritz Krüger):
Obwohl die meisten der geehrten Leser das Nähere in Betreff der
wirklich interessanten Begebenheit kennen werden, durch welche das
Schachspiel nach dem - eine Meile von Halberstadt entfernten - Dorfe
Ströbeck gekommen ist, so dürfte es doch nötig sein, dass wir dieselbe
mit wenigen Worten erst noch einmal vorausschicken, bevor wir in die
Einzelheiten der jetzigen Ströbecker Schachzustände, deren Erörterung
unsere Aufgabe in diesem Aufsatze sein soll, übergehen.
Es war in dem ersten Dezennium des elften Jahrhunderts, als vom Kaiser
Heinrich II. dem Bischof Arnulph ein Gefangener - der Graf Guncellin -
überwiesen wurde mit dem Befehle, denselben streng bewachen zu lassen.
Der Bischof ließ ihn in dem alten Turme, der noch jetzt im Dorfe steht,
festsetzen. Natürlicherweise wurde der arme Graf hier von der Langeweile
sehr geplagt, und deshalb begann er in seiner Einsamkeit Schachfiguren
zu schnitzen, um mit dem von ihm schon immer hochgeschätzten Spiele sich
im Gefängnis zu beschäftigen. Er verfertigte sich auch ein Schachbrett
und fing dann an, die bei ihm Wache haltenden Bauern im Schachspiel zu
unterrichten. Diese, denen die - ihnen bis dahin ganz unbekannte -
Beschäftigung sehr wohl gefiel, lehrten das Spiel wieder ihre Frauen und
Kinder, und bald spielten alle Einwohner des Dorfes das ihnen immer mehr
zusagende, herrliche Schach. - Als nun in späterer Zeit Graf Guncellin
wieder aus seiner Haft entlassen ward, schenkte er den Bauern sein
Schachspiel, welches sie lange Jahre als eine ihnen besonders werte
Reliquie aufbewahrt haben sollen. Seit jener Zeit hat sich in Ströbeck
die Kunst, Schach zu spielen, immer von den Eltern auf die Kinder
vererbt, so dass noch jetzt - soviel uns bekannt - kein einziger
Einwohner im Dorfe ist, der nicht Schach zu spielen verstände.
Es ist eine alte Erfahrung, dass das Schach den Geist ungemein bildet.
Goethe sagt am Anfang des 2. Aktes seines herrlichen Götz von
Berlichingen: "Es ist wahr, dies Spiel ist ein Probierstein des
Gehirns." - Welch treffender Ausspruch! Gewiss können wir täglich
hiervon Beispiele finden, und auch das Dorf Ströbeck liefert einen
unumstößlichen Beweis dazu. Während in allen umliegenden Ortschaften die
Einwohner jeden Sonntag viele Stunden in der Schenke beim Kartenspiel
verbringen, ziehen die Ströbecker dieser, gar keinen Einfluss auf die
höhere Bildung des Menschen ausübenden, Beschäftigung das geistreiche
Schach bei Weitem vor. Vielleicht sind auch eben aus dieser Vorliebe für
das edle Spiel die Ströbecker nicht bloß den umliegenden Örtern, sondern
sogar den meisten Gauen Deutschlands in einer anderen geistigen Kunst um
vieles voraus, ich meine nämlich - in der Tonkunst. Denn gerade durch
die weitere Ausbildung ihres Geistes ist ihr Sinn für das Schöne erhöht,
und so werden wir keine Ströbecker Familie finden, welche nicht - wenn
sie nur einigermaßen wohlhabend ist - aus Liebe zur Musik sich ein
Pianoforte angeschafft hätte - gewiss ein herrliches Zeichen vom Streben
nach höherer Bildung!
Die hauptsächlichsten und interessantesten Schachkämpfe in Ströbeck
werden im sogenannten "Wirtshaus zum Schachspiel" geführt. Hier finden
sich täglich die stärkeren Ströbecker Schachspieler zusammen, die dann,
während viele Zuschauer dabei stehen, ihre Kräfte in kühnem Wettstreit
miteinander messen. Als stärkste Spieler gelten jetzt daselbst der Herr
Zimmermeister Kraft und Herr Valentin Guerike – beide wegen ihres
bedeutenden Schachtalents in ganz Ströbeck rühmlichst bekannt.
Wir kommen nun auf die besonderen Gebräuche der Ströbecker hinsichtlich
des Schach. - Zuvörderst ist hier zu erwähnen, dass schon seit langer
Zeit die Durchreisenden daselbst immer zu einer Partie Schach
aufgefordert werden, die meistens für sie unglücklich abläuft. Aber auch
tüchtige Schachspieler sind zuweilen nach Ströbeck gereist, um dort zu
spielen, und Massmann erzählt uns in seiner Geschichte des Schachspiels,
dass der starke Schachheld Silberschmidt einst in Ströbeck gespielt und
es sich schriftlich habe attestieren lassen, dass er im Kampfe siegreich
gewesen sei, was auch gern von den Besiegten geschehen.
Ein anderer Brauch ist nun, dass selbst die Braut, wenn sie sich nach
außerhalb verheiratet, an ihrem Hochzeitstage mit dem Gemeindevorsteher
in Ströbeck erst noch einmal eine Partie spielt, (währenddessen muss sie
immer für die Gäste einiges Geld zum Besten geben, die sich dann mit
gefülltem Glase um die Kämpfenden herumstellen und es auch wohl an
Äußerungen des Beifalls, oder der Missbilligung bei den einzelnen Zügen
nicht fehlen lassen) – wahrscheinlich, damit sie auch in der Ferne das
edle Spiel ihrer Heimat stets in gutem Andenken behalten und es auch in
ihre neue Behausung mit hinübernehmen möge.
Sogar bei den Schulkindern in Ströbeck spielt das Schach schon eine
große Rolle. In jedem Jahre nämlich, zur Osterzeit - nachdem den Kindern
vorher aufgegeben ist, sich im Schach zu üben - wird in Ströbeck ein
großes Schach-Examen abgehalten, woran sich jedes Mal ungefähr 48 Kinder
beteiligen. Da sind denn immer bei Jedem gar große Hoffnungen auf Sieg
vorhanden, und auch an Prahlerei mit etwaigem Talente mag es bei den
Einzelnen nicht fehlen. Doch darauf achten die Ströbecker nicht, sondern
bei ihnen gilt der Wahlspruch: "Beweise durch die Tat, wie weit du
vorgeschritten bist!" Zuvörderst wird nun durch das Los bestimmt, welche
Paare den Kampf gegeneinander bestehen sollen, und nachdem dieses
geschehen, werden so viel Schachbretter zurechtgelegt, wie Paare von
Spielenden vorhanden sind, deren Anzahl meist gegen 24 beträgt. Sobald
die jugendlichen Kämpfer den ihnen angewiesenen Platz eingenommen haben,
beginnt der Kampf. Pläne über Pläne werden geschmiedet, Kombinationen
über Kombinationen in Anwendung gebracht, für jedes kleine Versehen, für
jeden unüberlegten Zug nimmt der Gegner die gehörige Rache, bis endlich
dieser erste Kampf bei allen entschieden ist. Nun treten die 24 Sieger
von neuem zusammen und spielen - nachdem das Los die gegenseitigen
Gegner bestimmt hat - gegeneinander eine zweite Partie, die natürlich,
da sie von schon besseren Spielern, als die ersten waren, geführt wird,
auch weit interessanter als jene ausfällt. Sobald nun auch dieser Kampf
von allen beendet ist, beginnt die letzte Partie, die auch gewöhnlich am
hartnäckigsten von der kampflustigen Jugend gespielt wird. Jeder sucht
da noch alle seine Pläne und Finten in Anwendung zu bringen, bis endlich
der Kampf durch den für die Besiegten so schrecklichen Ausruf des
Gegners: "Schach und Matt!" entschieden ist. Diejenigen sechs, welche
nun auch in dieser dritten Schlacht siegreich gewesen sind, werden
darauf im Jubel nach Hause begleitet, und deren Türflügel ihnen ehrerbietigst geöffnet; im Hause selbst ist die liebe Mama sogleich
eifrigst bemüht, ein kleines Festmahl anzurichten, um den dreifachen
Sieg des teuren Kindes zu feiern. - Auch seitens der Ströbecker Gemeinde
wartet noch auf die Sieger eine andere Belohnung, die darin besteht,
dass den tapferen Streitern ein schönes Schachspiel geschenkt wird,
welches die bei den Kindern so große Freude erzeugende Inschrift: "Zur
Belohnung des Fleißes von der Gemeinde Ströbeck" trägt. Zuweilen kommt
hierzu auch noch ein besonderes Geldgeschenk. - Dagegen finden wir an
diesem Festtage auf der Seite der Besiegten auch einzelne, sehr traurige
Gesichter und Tränen, die bei diesem Feste von denen vergossen werden,
denen der Sieg durch das geübtere Spiel des Gegners entzogen ward, sind
dabei nichts so sehr Seltenes. Wie manches der Kinder hat geglaubt,
durch seine fortwährende Übung im edlen Schach sicherlich zu der Zahl
der Gefeierten zu gehören, und nun sieht es plötzlich seine langgehegte
Hoffnung in Trümmer zerfallen. Die Zeit ist die beste Trösterin. So
erblicken wir denn auch viele von denen, die das vergangene Osterfest
mit weinenden Augen an sich vorübergehen sahen, im nächsten Jahre wieder
mit frischem Mute unter der Zahl der Kampflustigen.
Für denjenigen nun, welcher die von unseren Schachgesetzen abweichenden
Regeln des Ströbecker Spieles kennen lernen möchte, dürften folgende
Bemerkungen interessant sein:
1. Die bei uns gebräuchliche Rochade, sowohl nach der Damen- wie nach
der Königsseite, findet in Ströbeck nicht statt.
2. Jeder Bauer darf dort stets nur ein Feld ziehen, während man im
gewöhnlichen Schach die Erlaubnis hat, einen Bauer, wenn man ihn während
des ganzen Spiels zum ersten Male zieht, gleich zwei Felder vorzurücken.
3. Sobald ein Bauer in der Offizierreihe des Feindes glücklich
angekommen ist, darf er, so lange er auf diesem Platze steht, vom Feinde
nicht geschlagen werden. Es wird nämlich ein solcher Bauer nicht
sogleich in die gewünschte Figur umgetauscht, wie dies bei uns
gebräuchlich ist, sondern er muss erst noch drei Rücksprünge machen,
auch Freuden- oder Probesprünge genannt, die darin bestehen, dass er,
wenn er z.B. der c Bauer ist, im ersten Rücksprunge von c8 nach c6, im
zweiten von c6 nach c4 und im dritten von c4 nach c2 springen muss; dort
glücklich angelangt - denn er kann vom Feinde während seiner drei
Rücksprünge, sobald sich Gelegenheit bietet, geschlagen werden - darf er
erst in die gewünschte Figur verwandelt werden. Noch ist dabei zu
bemerken, dass es nicht notwendig ist, die drei Freudensprünge
hintereinander zu tun, sondern steht es stets frei, ob man - je nachdem
Vorteil daraus entspringt - die Sprünge in Pausen, oder schnell
aufeinander folgend machen will. - Es ist also die Verwandlung eines
Bauern in eine Dame, oder andere Figur bei den Ströbecker Schachspielern
mit weit bedeutenderen Schwierigkeiten verknüpft, als dies bei uns der
Bauer, wenn er in der Offizierreihe auch nicht, so doch jedenfalls
während der drei Freudensprünge sehr leicht geschlagen werden kann, und
somit häufig herrliche Hoffnungen auf die Wiedererlangung des schönsten
und wirksamsten Offiziers durch einen vom Gegner fein ersonnenen Schlag
zu Grabe getragen werden, während nach unsern Regeln wir uns nur
anzustrengen haben, den Bauer in die feindliche Offizierreihe zu
bringen, um dann einen bedeutenden Zuwachs unserer Streitkräfte zu
erhalten.
4. Endlich weicht auch noch der Ströbecker von uns in der Aufstellung
der Figuren vor Beginn des eigentlichen Spiels etwas ab. Es wird nämlich
daselbst sogleich der d Bauer (nicht wie bei uns auf d2) auf d4, und
hinter ihm auf das Feld d3 die Dame gestellt; ebenso bei den schwarzen
Steinen, wo der d Bauer (nicht wie bei uns auf d7) auf das Feld d5, und
hinter ihm auf d6 die Dame gestellt wird, indem man nämlich damit
andeuten will, dass es die Dame ist, welche - ihrem Vorreiter folgend -
als die tapferste Figur den Kampf eröffnet. Zugleich werden auch noch,
ehe die Partie beginnt, von jedem Lager aus zwei Vorposten (der a und h
Bauer) aufgestellt, welche anstatt auf a2, h2 und a7, h7, wie es bei uns
gehalten wird, zu stehen, sich keck auf den Feldern a4, h4 und a5, h5
gegenüberstehen, um eben gleichsam als Vorposten, oder als an der Grenze
des Lagers aufgestellte Wachen zu zeigen, wie weit ihr Lager sich
ausdehnt. Zur noch deutlicheren Erkenntnis, welches in Ströbeck die
Aufstellung der Schachtruppen vor Beginn der Partie ist, mag folgendes
Bild dienen:
Sobald die Aufstellung von beiden Seiten auf diese Weise formiert ist,
beginnt der eigentliche Kampf. —
Dies sind die Gebräuche und Regeln des Schachspiels in Ströbeck, welche
mir teils durch meinen einige Stunden dauernden Aufenthalt daselbst,
teils auch durch Nachrichten mehrerer in Magdeburg lebender Ströbecker -
besonders durch die Güte des Herrn H. Helmholz aus Ströbeck, der sich
jetzt in Magdeburg aufhält - bekannt geworden sind. Ich übergebe diese
von mir zusammengestellten Skizzen hiermit den geehrten Lesern, in der
Hoffnung, dass gewiss manche unter ihnen sind, die sich - gleich mir -
für dieses Dorf, welches von allen Örtern die meiste Zuneigung zu
unserem werten Spiele zeigt, ja in dieser Beziehung fast einzig dasteht,
lebhaft interessieren.
- Ende des Beitrags von Moritz Krüger -
1849 in der Juli Ausgabe der Berliner Schachzeitung erschien ab Seite 233 ein Beitrag von Otto von Oppen unter dem Titel Das Schachspiel in Ströbeck (Thüringen und der Harz, mit ihren Merkwürdigkeiten, Volkssagen und Legenden, 9. Heft, Nr. 36):
"Der Sage nach soll das Spiel unter dem Bischof Burkhard oder Bucko I.
von Halberstadt (1040-1045), der an den Feldzügen Kaiser Heinrichs III.
gegen die Wenden teilnahm, durch einen gefangenen Wendenfürsten, der in
Ströbeck in einem Turme festgehalten wurde, dort hin gekommen sein. Der
Turm wird noch gezeigt; und um die Einsamkeit seiner Haft zu mildern,
habe er, - wird gesagt - seinen Wächtern das Schachspiel gelehrt."
"Die Ströbeck'schen Bauern spielen das Schach deshalb nach ihren eigenen
Regeln, und mit einer Einfachheit und Würde, die über alle Neckereien,
deren sich so viele Spieler schuldig machen, weit erhaben ist. Sie
setzen die Ehre des Spiels nicht darin, ihren Gegner schachmatt zu
schlagen, sondern ihn schachmatt zu ziehen. Denn das Schachspiel hört
auf, ein bloßes Verstandesspiel zu sein und wird ein bloßes Glücksspiel,
sobald man es nur darauf absieht, sich einander die Steine vom Brette zu
schlagen. Das sogenannte Kapern, wo man, um dem Gegner drei Steine zu
nehmen, zwei von seinen eigenen opfert, ist in Ströbeck außer allem
Gebrauch. Kenner wissen, wie unangenehm es ist, wenn man nicht mit der
vollen Kraft aller Steine spielen kann. Hat man aber einen mutwilligen
Gegner, der selbst keinen gehörigen Plan entwirft, und es auch auf alle
Weise zu verhindern sucht, dass sein Gegner keinen entwerfen soll
—"
"Was für Deutsch!" ruft hier Bledow aus. Auch wir lassen es bei dieser Probe bewenden, welche so wenig für die Sprache als für die Kunst des Erzählers ein günstiges Zeugnis gibt, überdies aber der Wahrheit ermangelt. Bucko I. erfreut sich noch jetzt einer großen Popularität;
das Wiegenlied:
Bucko von Halberstadt
Bringe doch unseren Kinneken wat, etc.
ist dort in aller Ammen Munde; er mag daher durch ein Qui pro quo
(Personen-Verwechselung) in
den Sagenkreis des Dorfes Ströbeck gekommen sein. Gustavus Selenus
erwähnt des Schachspiels daselbst; Koch*) gedenkt der allerdings viel
wahrscheinlicheren Sage, dass ein Domkapitular des Stiftes zu
Halberstadt, der mit dem Bischofe zerfallen, sich nach Ströbeck
zurückgezogen hatte, den Einwohnern das Schachspiel bekannt gemacht und
dieselben, nachdem er selbst Bischof geworden, von manchen Abgaben frei
gemacht habe. Jeder Bischof von Halberstadt aber wird im Munde des Volks
bald zu Bucko I.
Jetzt kommt das Schachspiel in Ströbeck immer mehr in Verfall und wird
schon wegen der abweichenden Regel ein ganz anderes Spiel als unser
Schach. Ehe dasselbe nämlich beginnt, zieht jeder Spieler seine
Turmbauern zwei Schritte, den Bauer der Königin zwei Schritte und stellt
die Königin auf ihr drittes Feld; dies wird Aussatz genannt. Durch einen
solchen Aussatz müssen die Kombinationen des Spiels sich wesentlich
ändern, es ist aber nicht viel die Rede, und mit der gerühmten Großmut
der Dorfbewohner verhält es sich so, dass jeder schlägt, wie er weiß und
kann, sich aber wohl, wenn er matt geworden ist, darauf beruft, dass man
nicht matt schlagen, sondern matt ziehen müsse. Darin liegt denn auch
das Geheimnis, weshalb der Ströbecker seinen Sieger nie für seinen
Meister erklärt. Der Erzähler der Legende von dem Wendenfürsten liefert
den besten Beweis seiner Schach-Unschuld dadurch, dass er die volle
Kraft der Steine im vollen Brette sucht und zu finden glaubt.
Bei dieser Gelegenheit erbitte ich mir die Erlaubnis, eine Anekdote aus
meiner Jugendzeit zu erzählen. Im letzten Jahrzehnt des vorigen
Jahrhunderts lebte in Berlin ein guter Schachspieler, David Hillel, ihm
an Stärke ohngefähr gleich war ein anderer Meister, bekannt unter dem
Namen des Lederhändlers. Beide sprachen immer von einander mit der
höchsten Achtung, und Hillel sagte mit dem Ausdruck der innigsten
Überzeugung: "Der Lederhändler ist ein großer Mann!" Die
Kavallerieoffiziere aber, (zu ihnen gehörte mein Vater, dem H.
Schachunterricht gab) behaupteten: David Hillel gehe, besonders des
Abends immer mit hochgehobenem Stocke, um sich gegen einen möglichen
Keulenschlag des anderen großen Mannes zu decken. Später besuchte der
Schachmeister meinen Vater auf seinem Gute im Halberstädtischen, und
wurde auch dort wegen seiner Furchtsamkeit oft geneckt. Er drückte nie
ein Gewehr anders ab, als mit weggewandtem Gesicht; einmal feuerte er so
unter ein Volk Hühner und es gab eine ganze Wolke von Federn, denn seine
Flinte war voll Hühnerfedern geladen, damit er glauben möge, er habe
getroffen. Ein andermal bat er um eine Fahrt nach dem etwa 3 Meilen
entfernten Dorfe Ströbeck, denn wenn er die Bauern besiege, so werde ihm
der Herzog von Braunschweig, sagte er, vielleicht den Titel eines
Hofschachspielers oder dergleichen geben, und ein solcher Titel ihm in
Berlin Vorteil bringen.
Wir fuhren ab. Ich war damals ein Knabe von 8 bis 10 Jahren. Vor
Ströbeck angekommen, beauftragte mein Vater den Kutscher, auf mich zu
achten, "wenn's etwas gäbe". David Hillel fragte ängstlich: was es denn
geben solle? und mein Vater, der, wie wir sahen, den Scherz liebte,
sagte sehr ernsthaft: der Schachruhm der Ströbecker sei dadurch
entstanden und im Fortlauf der Zeit befestigt worden, dass jeder, der
eine Partie gewinne, Prügel bekomme. Hillel erschrak, konnte aber nicht
mehr zurück. Als die Partie begann, in der er einen Turm vorgab, wurde
seine Angst dadurch vermehrt, dass alle Bauern auf die Seite ihres
Spielers traten und der Ruf: "Gevatter mit Rat!" oft aus zehn Kehlen zu
gleicher Zeit erscholl. Er verlor noch einen leichten Offizier. Nur der
Zuspruch meines Vaters: "Alles sei ja nur ein Scherz gewesen, er habe
gar nichts zu fürchten etc.," gab dem bedrängten Meister die verlorene
Geistesgegenwart wieder, und er gewann doch noch das Spiel, verlor aber
dagegen die Hoffnung auf einen Titel wegen solches Sieges, denn er hatte
in der Tat, wie der weise Ritter von la Mancha, statt eines Heeres, eine
- Hammelherde besiegt. So viel von Ströbeck.
*) Einleitung § 3 in der Note und § 19.
Otto von Oppen, Berliner Schachzeitung, 1849
1861 erschien in der Warschauer Zeitung, in der Ausgabe Nr. 67
vom 11. - 23. März folgender Beitrag unter dem Titel: Das Schachspiel in Ströbeck
"Das Schachspiel, das geistreichste und älteste aller Spiele, ist gewiss
auch das auf dem Erdkreise am weitesten verbreitete Spiel, denn wo
irgend die Zivilisation ihren Fuß hingesetzt hat, da gibt es auch
Schachspieler, und bis zu welcher rätselhaften Fertigkeit es einzelne
Personen in Europa und Amerika darin gebracht haben uns die Zeitungen
schon oft erzählt. Alle großen Städte Europas haben daher ihre
Schachklubs, in Deutschland, England und Frankreich findet man sie aber
selbst in Städten mittlerer Größe. Seinen Ursprung betreffend deutet
schon das Wort "Schach" auf seine orientalische und zwar arabische oder
persische Abstammung, und da schon zu Harun al Raschids Zeiten das Spiel
bekannt war, so ist mit diesem Zeitgenossen Carls des Großen (800 n.
Chr.) auch sein hohes Alter erwiesen. Nach Deutschland und dem Westen
Europas soll es durch die Kreuzzüge gekommen sein. Einer Sage nach soll
es aber schon früher in Deutschland bekannt gewesen sein, und die
Kreuzzüge haben daher vielleicht nur zu seiner Verallgemeinerung
mitgewirkt. Ziemlich in der Mitte Deutschlands gibt es nämlich in der
preußischen Provinz Sachsen, unfern Halberstadt, einen Flecken Ströbeck
(Ströbke gesprochen), in welchem alle Bewohner vom reichsten bis zu
ärmsten, Männer und Weiber Schach spielen, ja es ist selbst eine vom
hohen Alter sanktionierte Sitte, dass bei Hochzeiten der Bräutigam sich
die Braut erst erspielen muss. Als Gegner wird ihm nämlich vom
Ortsvorstande jemand bestimmt, mit dem er auf der Ratsstube im Beisein
von Zeugen zu spielen hat. Gewinnt er die Partie, so ist die Braut sein,
verliert er sie, so muss er sie durch Geld, das dann verjubelt wird,
erst einlösen. Zuvor darf er mit ihr nicht ein Lager teilen. Auch die
beiden Gasthäuser führen das Schild "zum Schachbrett". Um aber die Liebe
zu jener alten Sitte recht wach zu erhalten, spielen nach abgehaltenen
jährlichen Schulexamen auch die Schulkinder nachmittags an diesem Tage
miteinander Schach, und es werden an die 6 Bestspielenden dann
Schachspiele als Prämien verteilt, wozu die preußische Regierung die
Kosten bestreitet. Man findet daher in diesem Flecken auch in jedem
Hause ein oder gar mehrere Schachspiele. Es wird auch eine besondere
Chronik über das Schachspiel und die besten Schachspieler hier geführt,
und sind die Bewohner stolz auf diese ihnen eigentümliche Sitte. Es
geschah nämlich auch in frühern Zeiten oft, dass hohe Herrschaften als
große Freunde des Schachspiels hierher kamen, um zu sehen, wie diese
Männer in ihrer schlichten altniedersächsischen Bauerntracht nicht bloß
den Pflug zu führen verstehen, sondern kaum vom Pferde gestiegen auch
ihre Schachfiguren zu stellen wissen. So besuchte sie oft und spielte
selbst mit ihnen der große Kurfürst von Brandenburg, Friedrich Wilhelm,
der größte Schachspieler seiner Zeit, der das berühmte Werk über das
Schachspiel, den "Gustav Selen" geschrieben hat. Er beschenkte sie auch
mit einem großen, mit Silber ausgelegten schönen Schachbrett nebst
silbernen Figuren. Das Schachbrett bewahren sie noch auf, doch die
Figuren sind ihnen im 7jährigen Kriege gestohlen worden, und sollen sich
jetzt in den Händen eines englischen reichen Lords befinden. Auch ein
Graf Ernst von Stolberg-Wernigerode spielte dort oft und ebenso holte
der Herzog Ludwig Rudolph von Braunschweig-Wolfenbüttel, Vater der
unglücklichen Prinzess Christine, (Schwiegertochter von Peter dem
Großen) einzelne jener Bauern oft nach seinem Schlosse Blankenburg, wo
er und seine Gemahlin dann mit ihnen Schach spielten. Diese Besuche,
womit man die Ströbecker in ihrem Flecken aufsucht, dauern auch noch bis
auf den heutigen Tag fort, und namentlich sind es jetzt Mitglieder aus
den Schachclubs größerer Städte, welche diese Bauern kennen lernen und
mit ihnen einmal Schach spielen wollen. Ihr Spiel hat nämlich mehrere
Eigentümlichkeiten, die sowohl im Auszuge (die Königin mit
vorgeschobenem Bauer) als darin bestehen, dass nicht rochiert und nicht
gekapert wird. Sie setzen ihre Ehre darin, ihren Gegner in der vollen
Kraft seiner Gegenwehr matt zu stellen, und halten sich darin auch für
nicht überwunden. "
![]()
1883 erschien in Leipzig in der Illustrirte Zeitung Nr. 2076
vom 14. April 1883 auf Seite 315 der Beitrag "Ströbeck, die Pflegestätte des
Schachspiels".
Um das Jahr 1150, so berichtet die Sage, hielt der damalige Bischof von
Halberstadt im Dorfe Ströbeck in dem heute noch existierenden Schach- und
Pfandturm einen Wendenfürsten gefangen, um denselben zur Annahme des
Christentums zu zwingen. Der Gefangene lehrte, um sich die Zeit zu kürzen, seine
Wächter das Schachspiel, und auf diese Weise soll dasselbe nach Ströbeck
gekommen sein.
Dass in Ströbeck schon seit Jahrhunderten Schach gespielt wird, beweist diese Erzählung; urkundlich ist es erst im Jahr 1651 nachgewiesen. Aber gerade diese Urkunde, welche sich in Holz ausgelegt auf einem von dem Großen Kurfürsten der Gemeinde Ströbeck geschenkten Schachbrett befindet, deutet auf ein hohes Alter des Schachspiels in Ströbeck hin, denn in ihr sind die Ströbecker Bauern schon als bedeutende Schachspieler genannt. Die Widmungsschrift auf dem Schachbrett von 1651 lautet: "Des Serenissimus Durchlaucht zu Brandenburg Herr Friedrich Wilhelm, dieses Schach und Courierspiel am 13. Mai Anno 1651. Dem Flecken Ströpke aus sondern Gnaden verehret, und bei ihrer alten Kunstfertigkeit zu schützen gnädigst zugesagt, solches ist zum ewigen Gedächtnis hierauf verzeichnet."
Auf dem betreffenden Schachbrett ist auch noch ein Schachrencontre mit Friedrich dem Großen aus dem Jahr 1744 verzeichnet. Friedrich der Große, welcher auf einer Durchreise von Frankfurt a. M. das Dorf Ströbeck berührte, ließ einen Bauer, den Schulzen, kommen, um mit demselben eine Partie Schach zu spielen; der "Alte Fritz" verlor jedoch, trotzdem er ein tüchtiger Schachspieler war, die Partie. Demzufolge sandte derselbe alljährlich einen Abgesandten nach Ströbeck, damit dieser mit einem Bauer vor versammelter Gemeinde eine Partie Schach spiele. Verlor der Abgesandte, was oft genug der Fall gewesen sein soll, so war die Ströbecker Gemeinde in dem laufenden Jahr von allen königlichen Abgaben frei. So soll es Friedrich der Große während seiner ganzen Regierung gehalten haben. Das Schachbrett wird von der Gemeinde im Gasthof "Zum Schachspiel" aufbewahrt, welcher als Schild ein Schachbrett trägt und das alte eigentliche Schachspielhaus in Ströbeck ist. In ihm befindet sich die Schachspielstube.

Stube im Gasthof zum Schachspiel in Ströbeck (Detail aus dem ganzseitigen
Holzstich von 1883)
Seit dem Jahr 1823 ist nun, wahrscheinlich um das Schachspiel in Ströbeck nicht aussterben zu lassen, alljährlich ein Schachwettspiel oder, wie die Ströbecker sagen, ein Schachexamen der Kinder in der Schule eingeführt, welches stets nach dem gewöhnlichen Schulexamen zu Ostern stattfindet. 48 Kinder aus der ersten Klasse, Mädchen und Knaben, werden alljährlich dazu bestimmt. Das eigentliche Turnier findet in der Schulstube unter den Augen des Pastors, der Lehrer und des Ortsvorstands statt. Die sechs besten Schachspieler unter ihnen werden von der Gemeinde mit einem kunstvoll gearbeiteten Schachbrett prämiert. Dass an diesem Schachexamen die ganze Gemeinde den regsten Anteil nimmt, ist wohl erklärlich, da ja jeder dasselbe ebenfalls einmal früher mitgemacht hat und ja auch jeder das Schachspiel versteht. Wochenlang, ja monatelang vor dem Examen werden die Kinder dazu eingeübt, und wochenlang vorher und nachher bildet das Schachexamen in Stöbeck das Tagesgespräch. Nicht unerwähnt darf bleiben, dass die Gemeinde von dem Kaiser Wilhelm ein Meisterschaftsdiplom für ihr Schachspiel nebst einer Goldenen Medaille erhalten hat, welches beides auf dem Ortsschulzenamt zu Ströbeck aufbewahrt wird.
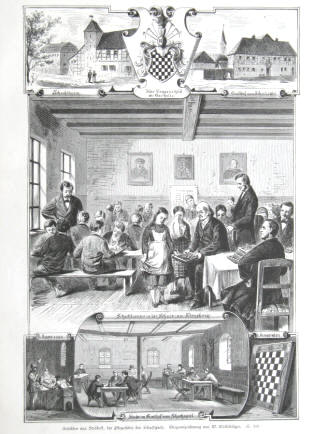
Schachturnier in der Schule zu Ströbeck 1883. (Ansichten aus Ströbeck von
1883 nach einer Zeichnung von Wilhelm Wollschläger, 1851-1941).
Das Dorf Ströbeck liegt eine Stunde von Halberstadt entfernt in einer höchst
fruchtbaren Gegend und ist ein reicher Ort; dieser Umstand mag viel zur
Erhaltung des Schachspiels bis auf die heutige Zeit beigetragen haben, denn arme
Bauern denken wohl nicht an das Schachspiel.
1890 erschien in dem illustrierten Familienblatt Die Gartenlaube, herausgegeben unter verantwortlicher Redaktion von Adolf Kröner im Verlag von Ernst Keil‘s Nachfolger in Leipzig, auf den Seiten 531-32 ein Beitrag mit Abbildungen unter der Überschrift "Das 'Schachdorf' Ströbeck" mit folgendem Text:
Wer von der alten Bischofstadt Halberstadt aus mit der Eisenbahn einen Ausflug in den Harz, z. B. nach Wernigerode, unternimmt und seine Blicke nach Nordwestest hin schweifen lässt, wird schon nach wenigen Minuten einen Kirchturm entdecken, dessen dunkle Spitze aus der im Norden vom Huywalde begrenzten Ebene hervorragt. Bald tauchen einzelne Häuser empor, und jetzt wird ein stattliches Dorf sichtbar, das in der Nähe der Eisenbahn von Süden nach Norden am Abhang einer mit Birken bestandenen Anhöhe, dem so genannten Hackenberge, sich hinzieht.
Es ist das Dorf Ströbeck, welches, einzig in seiner Art, seit Jahrhunderten eines großen Rufes sich erfreut, nicht nur in unserm deutschen Vaterlande, sondern weit darüber hinaus in allen zivilisierten Ländern diesseits und jenseits des Ozeans. Zwar ist weder ein berühmter Staatsmann oder Gelehrter aus seinen Mauern hervorgegangen, noch sind blutige, männervertilgende Schlachten auf seinen Gefilden geliefert worden, aber noch heute wird jahraus jahrein in dem sonst so friedlichen Dorfe wacker gekämpft und viele Schlachten werden geschlagen, Schlachten – auf den 64 Feldern des schwarz-weißen Schachbretts. So ist es von alters her gewesen, so wird es hoffentlich lange noch bleiben! Ströbeck ist aus der ganzen Welt das einzige Dorf, wo das edle Schach gepflegt und von Alt und Jung, von Männlein und Fräulein gespielt wird; und von jeher haben die Ströbecker ihren Ruf als tüchtige Schachspieler zu wahren und zu mehren gewusst.
Schon von Kindesbeinen an wird das "königliche Spiel" erlernt, zwar nicht in der Schule, wie man früher irrtümlich annahm, sondern daheim unter der Leitung der Eltern und Geschwister; wohl aber findet alljährlich zu Ostern nach Beendigung der Schulprüfung unter den Augen des Predigers und der Lehrer, sowie des Ortsvorstandes ein Schachturnier der Kinder statt, und die aus demselben als Sieger hervorgehenden drei Knaben und drei Mädchen erhalten in Ströbeck angefertigte Schachbretter mit der Inschrift: "Zur Belohnung des Fleißes".
Ströbeck hat seinen Männer- und Frauenschachklub, und der im Gasthof "Zum Schachspiel" einkehrende Wanderer kann des Sonntagnachmittags die biederen Ströbecker mit ernsten Mienen bei einer "Partie" sitzen sehen und, wenn er selbst des Spieles kundig ist, wohl auch einen Gang mit ihnen wagen. Aber wehe, wenn er nicht sattelfest ist! Bald wird er in den Sand gestreckt und unter dem Schmunzeln des Gegners und der Zuschauer "matt gesetzt".
Diese sonntäglichen Partien sind neben dem Kartenspiel gewissermaßen die Erholung von den Beschwerden und Mühen des alltäglichen Berufes; denn die Bewohner des etwa 1250 Seelen zählenden Dorfes treiben fast alle Ackerbau und erfreuen sich bei dem ertragreichen Boden mehr oder minder einer gewissen Wohlhabenheit. Daher macht denn das Dorf selbst auch einen freundlichen und stattlichen Eindruck; die Wohnhäuser und die Wirtschaftsgebäude sind massiv und in gutem Zustande, die Straßen gepflastert und sauber gehalten. Ungefähr in der Mitte des Dorfes, an der Westseite, steht die Kirche, deren Wetterfahne ein Schachbrett zeigt, während die Schule im Nordosten dicht am so genannten "Markt" liegt, dessen Südseite von dem "Gasthof zum Schachspiel" begrenzt wird. An der bei diesem Gasthof nach Westen vorüberführenden Straße erblickt man einen kleinen, aus Sandstein erbauten und mit Ziegeln gedeckten, viereckigen Turm, den sogen. "Schachturm", der in der Geschichte Ströbecks, wie wir unten sehen werden, eine wichtige Rolle spielte und noch heute zu den Sehenswürdigkeiten Ströbecks gehört. Ein in vieler Hinsicht so bedeutender Ort ist natürlich Post- und Telegraphenstation und Sitz eines Arztes.
Da Ströbeck zum "Harzer Schachbunde" gehört, so wird seit 1885 alle fünf Jahre daselbst ein großer Schachkongress in den letzten Tagen des Juni abgehalten; und auch dieses Jahr eilten von nah und fern die Jünger und Meister im Schach herbei, um in dem berühmten "Schachdorf" im Turnier eine Lanze zu brechen.
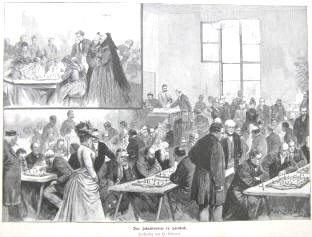

Das Schachturnier in Ströbeck nach einer Zeichnung von Hermann Lüders
(1836–1908)
Der geneigte Leser wird nun fragen: Wie kommt es, dass gerade in Ströbeck das Schachspiel eine so große Verbreitung gefunden und Jung und Alt in seinen Kreis gezogen hat? Auf diese wohlberechtigte Frage lässt sich leider nicht mit Sicherheit antworten, da die Geschichte über den Ursprung des Schachspiels in Ströbeck keinen Aufschluss gibt; nur die Sage berichtet uns zwei Begebenheiten, die wir nach den von dem Lehrer Karl Elis im Jahre 1848 herausgegebenen "kurzgefassten historischen Nachrichten von Ströbeck" hier wiedergeben:
"Dem Bischof Arnulf von Halberstadt wurde im Jahre 1011 vom Kaiser Heinrich II. ein vornehmer Staats- und Kriegsgefangener, der Graf Guncellin, überwiesen, damit er ihn, ohne dass es jemand erfahre, in dem alten Turm von Ströbeck, der noch jetzt im nördlichen Teile des Dorfes steht, so lange gefangen halten, bis ihm weitere Befehle darüber zugehen würden. Vielleicht sollte der Gefangene auch durch ein großes Lösegeld die Kriegskosten vermindern helfen. Die Bauern mussten nun immer abwechselnd bei ihm Wache halten, und da sie glimpflich mit ihm umgingen, so unterhielt er sich freundlich mit ihnen, schnitzte aus Langeweile Schachfiguren, fertigte ein Schachbrett an und ward, um sich die Zeit besser vertreiben zu können, nun der Lehrer im Schachspiel, worin er Meister war. Mit Lust und Liebe ergriffen die Bauern diese Gelegenheit, ein so schönes Spiel zu erlernen, und bald kannte man im Dorfe kein anderes Spiel mehr. Als der Graf nach längerer Zeit wieder in Freiheit gesetzt wurde, schenke er den Bauern sein Schachspiel."
Eine andere Überlieferung ist folgende: "Als Bischof Burchhard II. auf seinem Zuge gegen die Wenden im Jahre 1068 einen vornehmen Wenden gefangen nahm, ließ er ihn in den Ströbecker Zwinger sperren und den Wenden bekannt machen, dass er ihn so lange gefangen halten werde, bis sie die Friedensbedingungen erfüllt und ein ansehnliches Lösegeld geschickt hätten. Dieser vornehme Wende lehrte die Ströbecker das Schachspiel und verkürzte sich dadurch die unangenehme Zeit seiner Gefangenschaft. Nach Unterwerfung der Wenden hielt der Bischof auf einem weißen Rosse, das die Wenden wie einen Abgott verehrten und das er ihnen genommen hatte, seinen glänzenden Einzug in Halberstadt; der Wende aber kehrte in seine Heimat zurück, nachdem er die freundlichen Ströbecker reichlich beschenkt hatte. Das Spiel wurde nun vielfach bekannt, aber man nannte die Bauern 'Wenden', wohl um die Herabwürdigung dieses von den Deutschen unterjochten Slawenstammes zu bezeichnen."
Seit dieser Zeit haben die Ströbecker das Recht, jedem neuen Landesherrn, der
ihren Ort berührt, auf freiem Felde aus einem Tische eine Partie Schach anbieten
zu dürfen, was sie bisher auch immer getan haben. Friedrich Wilhelm der Große
Kurfürst fand bei seiner Durchreise ein Vergnügen daran, die ländlichen
Schachkünstler zu prüfen, und er fand mehr als er suchte, weshalb er dem Dorfe
das noch jetzt als kostbarer Schatz im Gemeindehause aufbewahrte, mit Elfenbein
ausgelegte Schachbrett verehrte. Auf der einen Seite dieses Schachbrettes sind
die 64 Felder des Schachspiels, auf der andern die des Kurierspiels, welches,
eine Art komplizierten Schachs, 32 Felder und für jeden Spieler 8 Steine mehr
enthält. Auf dem Rande des Schachbrettes sieht man Ströbeck in erhabener Arbeit
mit der Umschrift:
"Daß Sereniss. Churfürstliche Durchlaucht von Brandenburg und Fürst von
Halberstadt, Herr Friedrich Wilhelm u. s. w. dieses Schach- und Courierspiel am
13. Mai 1651 dem Flecken Ströbeck aus sondern Gnaden verehret und bei ihrer
alten Freiheit zu schützen zugesaget, solches ist zum ewigen Gedächtniß hier
aufgezeichnet.
Paul Langenstraß. B. Valentin Rieche, Richter. Andreas Bartels, Baur. Meist.
Hans Ilsen. B. Valentin Langenstraß, Richter. Hans Hartmann, Baur. Meist.
Renovatum Anno 1744. M. Heinrich Wilke me fecit."
Die dazu gehörigen Figuren waren sehr wertvoll, und zwar der eine Teil von Silber, der andere von Silber mit Vergoldung; leider sind sie aber nicht mehr vorhanden, da sie durch Verleihen an das Domstift zu Halberstadt verloren gegangen sein sollen.
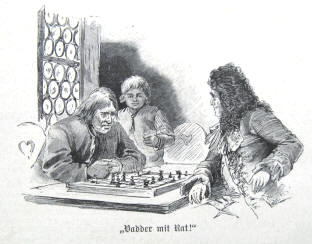
Schachpartie von Herzog Ludwig Rudolf von Braunschweig gegen den Dorfschulzen
Söllig auf Schloss Blankenburg im Harz
Auch ein anderer Fürst, Herzog Ludwig Rudolf von Braunschweig, der im vorigen Jahrhundert regierte, spielte gern mit den Ströbeckern eine Partie Schach, so bei Gelegenheit der Vorstellung einer Bauernhochzeit auf dem Schloss zu Blankenburg a. H., wo er mit dem Schulzen Söllig von Ströbeck spielte, hinter dem sein achtjähriger Sohn stand und das herkömmliche "Vadder mit Rat!" bei einem bedenklichen Zuge rief. Der Herzog wurde infolgedessen auf den jungen Söllig aufmerksam, ließ ihn unter seiner Aussicht erziehen und zu einem tüchtigen Geistlichen ausbilden.
So hat im Laufe der Jahre das Schachspiel in Ströbeck sich eingebürgert und bei dem regen Interesse, das man ihm entgegenbrachte, den Vorrang unter den übrigen Spielen behauptet. Die Ströbecker sind auch in der Theorie bewandert und haben sich die moderne, internationale Spielweise angeeignet, ein für die Beteiligung an auswärtigen Turnieren nicht zu unterschätzender Vorteil. So möge denn das edle Spiel in dem einzigen "Schachdorfe" fortblühen und als ein von den Vorfahren überkommenes Erbe immer in Ehren gehalten werden!
Anmerkung: Die Schreibweise des Grafen "Guncellin" in den verschiedenen Zeitungen des 19. Jahrhunderts sollte m. E. richtig lauten "Gunzelin".
|
|